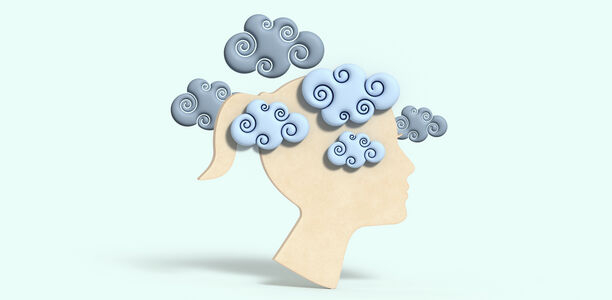Das Delir ist die häufigste Komplikation älterer Patient:innen nach einer Operation, häufig mit gravierenden Spätfolgen für die Betroffenen. Eine kausale Therapie gibt es nicht, mit dem entsprechenden Wissen können Patient:innen und ihre Angehörigen jedoch der Entstehung wirksam vorbeugen. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über Risikofaktoren, Pathogenese und Prophylaxe des postoperativen Delirs.
Das Delir, von lateinisch delirare "ver-rückt sein", hatte in der Geschichte der Medizin viele Namen, Beschreibungen finden sich bereits in medizinischen Fachartikeln des 17. Jahrhunderts. Begriffe wie Durchgangssyndrom oder hirnorganisches Psychosyndrom sind jedoch heute obsolet. In der internationalen Klassifikation von Krankheiten und Gesundheitsproblemen (ICD) ist das Delir definiert als ein ätiologisch unspezifisches hirnorganisches Syndrom, das charakterisiert ist durch gleichzeitig bestehende Störungen des Bewusstseins einerseits und mindestens zwei der nachfolgend genannten Störungen andererseits: Störungen der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, des Denkens, des Gedächtnisses, der Psychomotorik, der Emotionalität oder des Schlaf-Wach-Rhythmus. Die Dauer ist sehr unterschiedlich und der Schweregrad reicht von leicht bis zu sehr schwer. Delirien können als Symptom psychiatrischer Erkrankungen oder als Alkoholentzugsdelir auftreten, auch bei schwer erkrankten Kindern kann es zu Delirien kommen, letztere Erscheinungsformen unterscheiden sich aber hinsichtlich Risikofaktoren und Pathogenese und sollen in diesem Artikel nicht behandelt werden.
Ein Delir ist die häufigste Komplikation älterer Menschen nach einer Operation, beschriebene Inzidenzen reichen von 4% (Kataraktchirurgie) bis nahezu 80% (kardiochirurgische Eingriffe) [1, 2]. Eine Operation ist jedoch keineswegs erforderlich, um ein Delir zu erleiden, durchschnittlich ist jede dritte ältere Patient:in einer nichtchirurgischen Bettenstation während des Krankenhausaufenthaltes davon betroffen, hohe Raten an Delirien finden sich zum Beispiel in der Onkologie und Strahlentherapie. Auch ältere Patient:innen, die über die Notaufnahme aufgenommen werden, sind bei Einlieferung in das Krankenhaus oftmals bereits delirant. Ein präklinisches Delir kann sich zu Hause durch akute Erkrankung, durch längere Liegedauer nach einem Sturz oder krankheitsbedingte Dehydratation entwickeln.
Risikofaktoren und Pathogenese
Bei der Genese des Delirs wird zwischen patienteneigenen Risikofaktoren und behandlungsassoziierten Triggerfaktoren unterschieden. Zu den besonders prädisponierenden Faktoren zählen ein hohes Lebensalter und kognitive Leistungsminderungen, aber auch Frailty (Altersgebrechlichkeit), Multimorbidität, Mangelernährung, Depressivität und Angst definieren das Risiko eines Menschen, ein Delir zu erleiden [3]. Sämtliche Zustände, die mit einer Behandlung im Krankenhaus einhergehen, können ein Delir auslösen. Die stärksten Trigger stellen eine Operation sowie intensivmedizinische Behandlung und das Auftreten von postoperativen Komplikationen dar, aber auch Dehydratation, anticholinerge Medikation, Schmerzen, Immobilisation und der Aufenthalt in der fremden Umgebung des Krankenhausalltags stellen potenziell delirogene Noxen dar. Je ausgeprägter das individuelle Risikoprofil, desto geringere Trigger reichen aus, um ein Delir hervorzurufen und umgekehrt. Die höchsten Delirraten im Krankenhaus finden sich demnach bei Patient:innen in intensivmedizinischer Behandlung und nach invasiven, oftmals komplikationsreichen Operationen. Hier sind die behandlungsassoziierten Triggerfaktoren besonders ausgeprägt, so dass oftmals sogar jüngere, wenig vorerkrankte Menschen ein Delir entwickeln. Die am meisten von Delirien betroffene Patientengruppe ist die der älteren Menschen: Hier können allein die Immobilisation im Krankenhausbett und die fremde Umgebung bereits ausreichen, um ein Delir zu triggern.
In Modellen zur Pathogenese des Delirs spielen Prozesse der neuronalen Zellalterung und des im Alter vorliegenden systemischen und zentralen pro-inflammatorischen Status eine Rolle. Im Gehirn kommt es zu einer Reduktion neuronaler Verbindungen und einer Permeabilitätssteigerung der Blut-Hirn-Schranke, einer Dysregulation des Neurotransmitter-Gleichgewichtes mit einer Abnahme an Acetylcholin und einem relativen Dopaminüberschuss sowie einer gestörten Regulation zerebral gesteuerter Prozesse wie des Schlaf-Wach-Rhythmus. Neuroinflammation, oxidativer Stress sowie neuroendokrine und zirkadiane Dysregulation schaffen ein vulnerables System, in dem exogene, delirogene Noxen schließlich zu einem Zusammenbruch der geordneten zerebralen Konnektivität und Interaktion führen. Das Delir manifestiert sich dadurch als akute zerebrale Dekompensation [4]. Abhängig von dem Areal und Ausmaß des Zusammenbruches äußert sich das Delir in einer hypo- oder hyperaktiven Form, oftmals auch in Mischformen.
Manifestation und Screening
Das hyperaktive Delir ist gekennzeichnet durch produktive Symptomatik, optische oder akustische Halluzinationen, Agitation, gelegentlich auch aggressives Verhalten oder Bettflucht. Während eines hypoaktiven Delirs hingegen wirken die Patient:innen in sich gekehrt, sind verlangsamt, ruhig und teilnahmslos. Das hypoaktive Delir tritt besonders häufig bei älteren Menschen auf und ist mit einer höheren langfristigen Morbidität und Mortalität assoziiert als das hyperaktive Delir [5]. Ist der präoperative Status der Patient:innen unbekannt, werden ältere Menschen im hypoaktiven Delir oftmals als "dement" oder "depressiv" wahrgenommen und verkannt. In der überwiegenden Anzahl aller Delirien – in bis zu 80 % der Fälle - treten hypo- und hyperaktive Phasen intermittierend auf, rein hyperaktive Delirien sind selten. Aufgrund dieser Besonderheit und der typischen Fluktuation deliranter Zustände – ein Betroffener kann morgens delirant, tagsüber wieder orientiert und unauffällig und abends und nachts erneut im Delir sein – besteht interdisziplinärer Konsens über die Notwendigkeit eines regelmäßigen Delirscreenings. Ohne Screening werden drei von vier Delirien nicht erkannt [6]. Es wird empfohlen, alle acht Stunden ein Delirscreening durchzuführen, beginnend im Aufwachraum und durchgehend bis zum fünften postoperativen Tag [7]. Auch in der Notaufnahme und auf nichtoperativen Stationen ist ein Delirscreening sinnvoll, ebenso bei Patient:innen im Pflegeheim oder zu Hause beim Arztbesuch im Rahmen einer akuten Erkrankung. Eine Vielzahl von validierten und ins Deutsche übersetzten Screeninginstrumenten ist verfügbar, eine Empfehlung, welches Instrument für welches klinische oder außerklinische Setting benutzt werden soll, gibt es nicht. Einige Screeninginstrumente sind ausschließlich für die Anwendung im intensivmedizinischen Bereich vorgesehen (z.B. der CAM-ICU [8]), andere eignen sich eher zur einmaligen denn zur repetitiven Testung von Patient:innen (z.B. 4AT [9]).
Delir erkannt – und nun?
Wird ein Delir erkannt, sollte unverzüglich gehandelt werden, denn je länger ein Delir andauert, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit von späteren kognitiven Einbußen und desto gravierender können diese ausfallen [10]. Eine kausale Therapie des Delirs gibt es nicht, die Maßnahmen, mit denen ein manifestes Delir durchbrochen werden kann, entsprechen denen, die auch in der Prävention des Delirs zum Tragen kommen. Medikamente – hochpotente Neuroleptika oder Benzodiazepine in möglichst niedriger Dosierung und möglichst kurzer Anwendung – werden ausschließlich zur Symptomkontrolle eingesetzt; z.B. Haloperidol 0,5 – 5 mg Tagesdosis bei quälenden Wahnvorstellungen oder Lorazepam 0,25 – 1 mg bis maximal 2,5 mg Tagesdosis bei unkontrollierbarer Agitation. Ein hypoaktives Delir bedarf keiner medikamentösen Behandlung. Ein Delir ist – aufgrund der Schwere der möglichen Spätfolgen – ein medizinischer Notfall, jedoch nicht akut lebensbedrohlich. Eine Verlegung auf die Intensivstation ist daher nicht indiziert und aufgrund der grundsätzlich Delir-fördernden intensivmedizinischen Umgebung eher als kontraproduktiv zu betrachten. Dem zeitnahen Hinzuziehen von Vertrauenspersonen an das Krankenbett – oder alternativ dem Einsatz von Sitzwachen – kommt diesbezüglich eine wesentlich wichtigere Rolle zu.
Wird ein Delir erkannt, spielt vor allem die Suche nach zugrundeliegenden Ursachen eine Rolle – denn ein Delir entsteht nicht selten als erstes Symptom von sich anbahnenden Komplikationen: Eine beginnende Pneumonie oder ein Harnwegsinfekt, eine Wundinfektion oder ein akutes Koronarsyndrom können ein Delir ebenso auslösen wie unzureichend behandelte Schmerzen, ein Harnverhalt oder eine Elektrolytentgleisung. Auch neu verordnete Medikation mit anticholinergem Potenzial kann ein Triggerfaktor sein.
Delirprophylaxe – an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Behandlung
Gerade weil ein Delir nicht kausal behandelt werden kann, kommt der Prävention eine besondere Bedeutung zu. Eine erfolgreiche Delirprävention lässt sich nur im Rahmen von Multikomponentenprogrammen erzielen und erfordert die Mitarbeit aller Behandler:innen, auch Patient:innen und Angehörige sollten eingebunden werden. Die Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen und Krankenhausärzt:innen ist hier besonders wichtig, denn eine gute Planung des Krankenhausaufenthaltes kann bereits ambulant begonnen werden. Perioperative Delirprävention beginnt mit der entsprechenden Aufklärung der Patient:innen und ihrer Angehörigen, diese sollten wissen, was ein Delir ist und wie sie selber präventiv tätig werden können. So wird empfohlen, Gegenstände, die die fremde Krankenhausumgebung vertrauter erscheinen lassen, mit ans Bett zu nehmen: Fotos, eigene Zeitschriften und Bücher, gern gehörte Musik oder ein Lieblingskissen. Kalender und Uhr gehören ebenso verfügbar auf den Nachttisch wie erforderliche Seh- und Hörhilfen. Für eine gute Schlafhygiene auch auf Station sollten Ohrstöpsel, Schlafbrillen oder gewohnte "Zu-Bett-geh"-Rituale verfügbar und durchführbar sein. Patient:innen sollten angehalten werden, ausreichend zu trinken und unnötige Nüchternheitszeiten vor Operationen zu vermeiden: Zwei Stunden für Flüssigkeiten (mit Ausnahme von Milch und Fruchtfleisch-haltigen Säften) und sechs Stunden für feste Nahrung sind ausreichend [11]. Ebenso wichtig ist es, darüber zu informieren, dass Schmerzen nach einer Operation kommuniziert und keineswegs ausgehalten werden sollen – keine Selbstverständlichkeit für ältere Menschen, die oftmals noch der Überzeugung sind, Schmerzen "gehörten dazu"; auch die Angst vor vermeintlich süchtigmachenden Analgetika ist noch weit verbreitet. Gerade bei kognitiv eingeschränkten Patient:innen ist die enge Einbindung von Angehörigen oder Vertrauenspersonen von besonderer Bedeutung, einige Krankenhäuser bieten inzwischen sogar ein Rooming-in an. Nach der Operation sindrasche Mobilisation, geistige Anregung, viel Ansprache und Besuchszeit sowie eine kontinuierliche Re-Orientierung förderlich, um die Entstehung eines Delirs zu vermeiden.
Delir – das wird schon wieder?
Ein Delir ist selbstlimitierend, die akuten Symptome bilden sich in der Regel nach einigen Tagen zurück und die Patient:innen werden in vermeintlich "gutem" oder "gebessertem" Zustand nach Hause entlassen. Die Spätfolgen eines einmal aufgetretenen Delirs sind jedoch für die betroffenen Patient:innen und ihre Angehörigen gravierend. Bei Patient:innen in intensivmedizinischer Behandlung kommt es durch ein Delir im Durchschnitt zu einer Verlängerung der Beatmungszeit um zwei Tage, und das statistische Risiko, im Krankenhaus zu versterben, steigt um ein Drittel an [12]. Ein stattgefundenes Delir erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren postoperativen Komplikationen kommt, die Wiederaufnahmerate in das Krankenhaus steigt und auch im mittel- und langfristigen Verlauf bleiben Morbidität und Mortalität erhöht [13]. Das Risiko einer verzögerten kognitiven Erholung und bleibender kognitiver Einbußen ist nach einem postoperativen Delir erhöht, nach einem Jahr bemerken noch 10% der betroffenen Patient:innen eine Einschränkung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit im Vergleich zum präoperativen Niveau [14]. Dies kann gerade bei Menschen mit vorbestehenden leichten kognitiven Einschränkungen, die vor dem Krankenhausaufenthalt noch zu Hause leben konnten, den Verlust der Selbstständigkeit bedeuten.
Mit den durch das Delir entstandenen Schäden sind die Patient:innen, ihre Angehörigen und Hausärzt:innen konfrontiert. Für die Behandelnden im Krankenhaus bleiben diese in der Regel inapparent, nicht zuletzt deshalb fristete das Delir im Bewusstsein der meisten Krankenhausmediziner:innen abseits der Geriatrie lange ein Schattendasein. Einen Wendepunkt in der klinischen Bedeutung des Delirs stellte die 2015 erschienene S3-Leitlinie "Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin" dar [15]. Zwei Jahre später definierte der Gemeinsame Bundesausschuss die "Prävention des postoperativen Delirs bei der Versorgung von älteren Patientinnen und Patienten" als einen von vier Leistungsbereichen in der Krankenversorgung, in denen "besondere Qualitätsverbesserungspotenziale bekannt" seien [16]. Inzwischen existiert eine solide Evidenz bezüglich Screening und Prävention des postoperativen Delirs mit einer Vielzahl an nationalen und internationalen Leitlinien und Handlungsempfehlungen auf diesem Gebiet. Die Sensibilisierung von Ärzt:innen und Pfleger:innen für dieses Thema, die Umsetzung und Implementierung von perioperativen Konzepten zur Delirprävention in den Krankenhäusern und im ambulanten Setting erfordern zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen. In Zukunft könnte jedoch die Delirinzidenz eines Krankenhauses ein Qualitätsindikator werden, anhand dessen sich die Güte der medizinischen Versorgung älterer Menschen beurteilen lassen muss.
- Ein Delir kann im Krankenhaus auftreten, aber auch zu Hause, z.B. nach langer Bettlägerigkeit.
- Je ausgeprägter das individuelle Risikoprofil, desto geringere Trigger reichen zur Auslösung eines Delirs aus.
- Es gibt hyperaktive und hypoaktive Delirformen.
Dr. med. Cynthia Olotu
Erschienen in: doctors|today, 2023; 3 (4) Seite 38-41